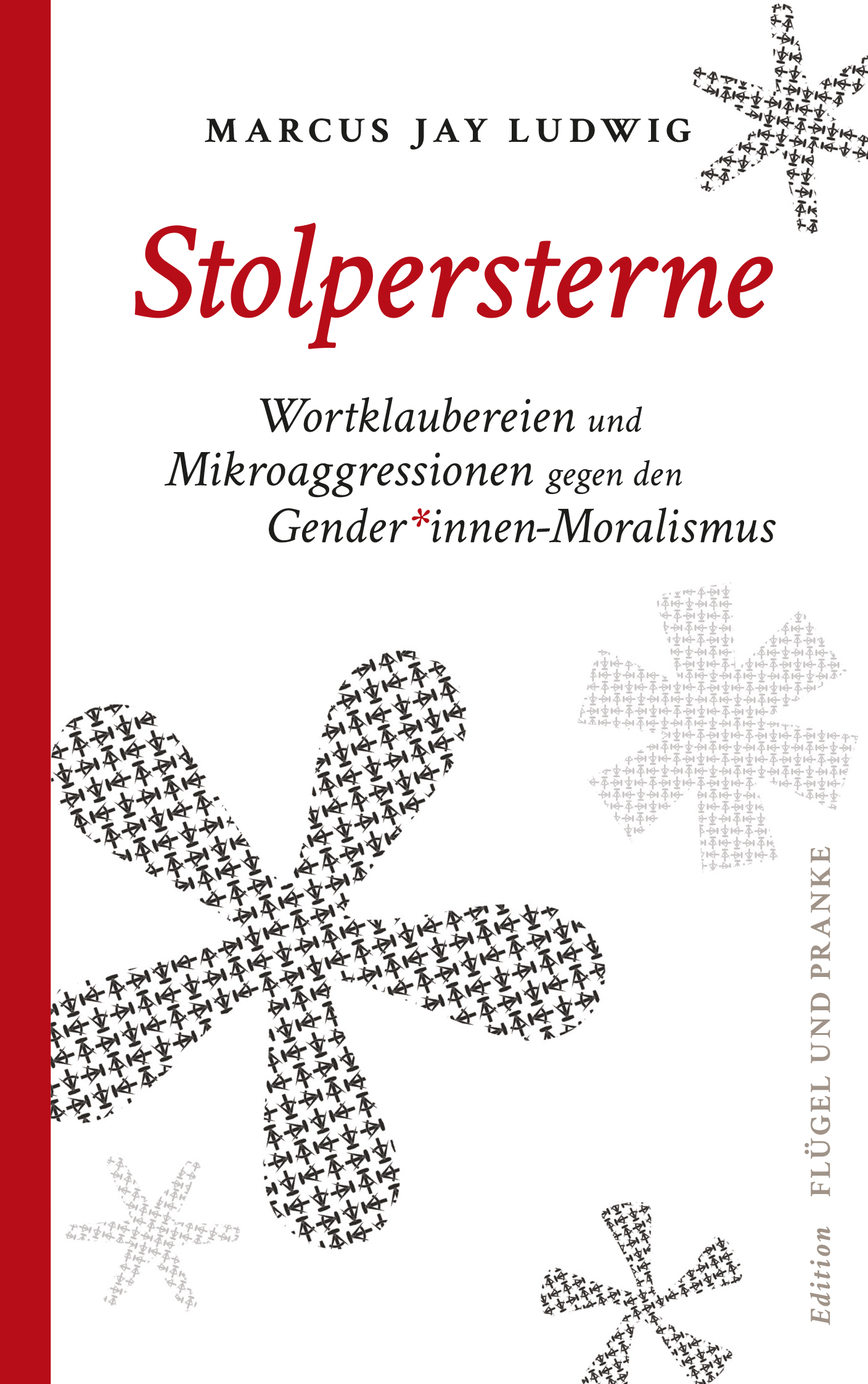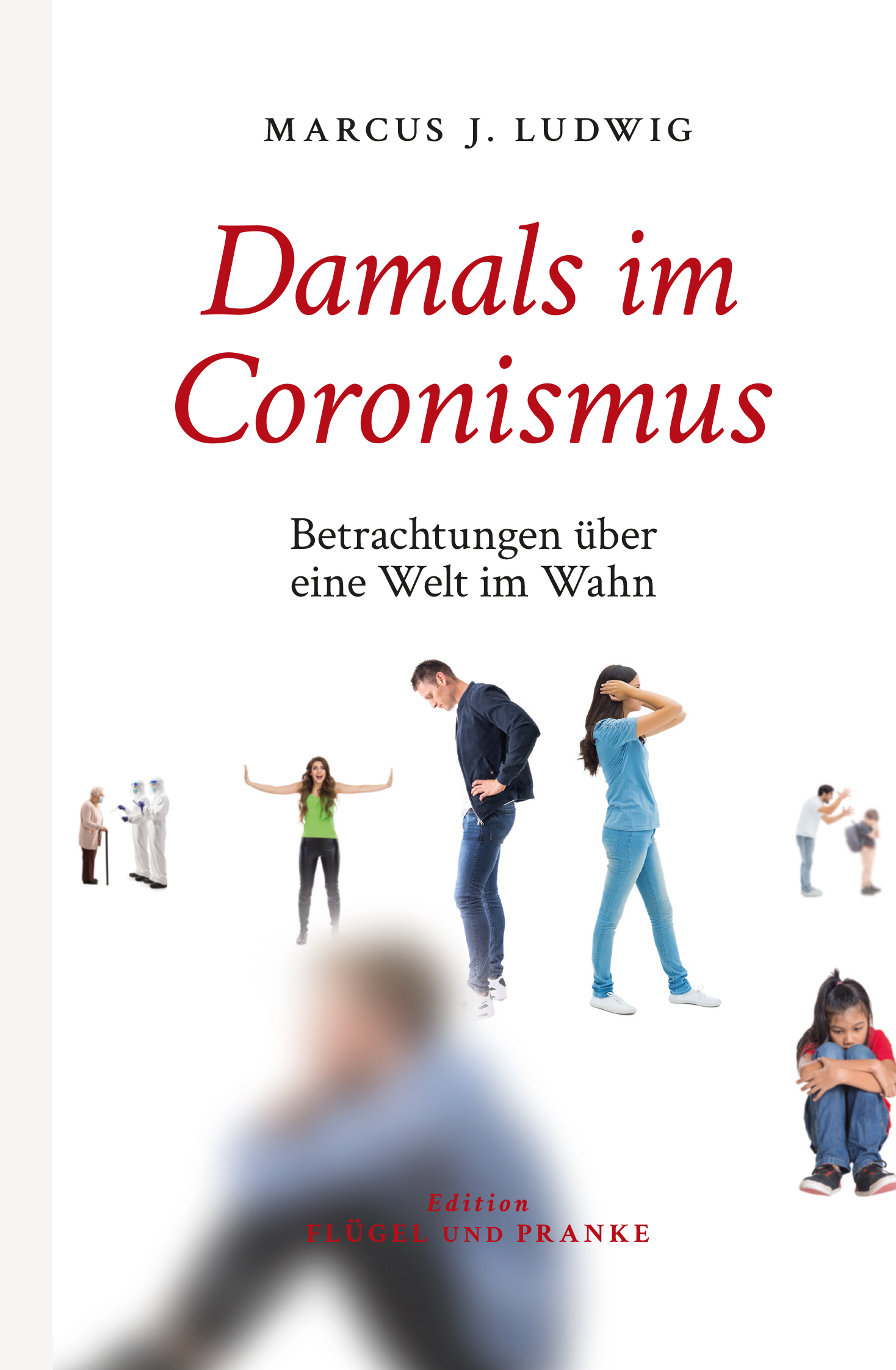Planänderung: Das „Projekt Schmierheft“ wird unterbrochen wegen Recherchereise. Als Pausenmusik stelle ich hier einen altbewährten Text hin, den mancher Flugschriften-Frischling vielleicht noch nicht kennt und mancher Habitué vielleicht gern repetieren möchte. Ich jedenfalls dachte dieser Tage beim Durchblättern: Och joa, durchaus, doch doch, kann man lesen. (Es empfiehlt sich, hier und da zu bedenken, dass der Essay um die Jahreswende 2019/20 verfasst worden ist; ich sehe aber nicht, dass er durch die Corona-Anomalie irgendwie widerlegt wäre.)
Das sehenswürdige Leben – Ein paar Worte über radikale Bürgerlichkeit
1. Homo Burgensis und Hitlerprophylaxe
Der Bürger als Phänotyp entstammt einer Zeit, da Kultur und Zivilisation noch nicht derart auseinanderklafften wie heute. Wer heute beiläufig vom Bürger spricht, meint meist den Staatsbürger, also den Inhaber eines Passes, oder den Steuerbürger, also den von anonymen Apparaten abkassierten Beitragszahler, oder den Wahlbürger, den sporadisch zur Entscheidung über Pest oder Cholera genötigten Kreuzchenkritzler. Man spricht also vom Bürger als funktionaler, gesichtsloser, massenhaft-millionenfacher Kleinst-Einheit einer Population, eines Elektorats, einer fiskalischen Schicksalsgemeinschaft.
Von diesem bedauerlichen Wesen ist hier natürlich nicht die Rede. Wovon dann? Nun, sagen wir zur vorläufigen Einkreisung: Wir reden vom Bürger als einem Mitmenschen von spezifischem charakterlichen und stilistischen Format. Wir reden von einem Wesen mit einem bestimmten Ethos und einem bestimmten Habitus.
Dieses Wesen ist in seinen historischen Anfängen zunächst mal bloß der Bewohner einer Burg. Das versteht man heute nicht mehr so recht, da man meint, auf einer Burg wohnen Adelige, Grafen, Ritter und dergleichen, also eben nicht Bürger, sondern Burgherren und -herrinnen. Aber es gibt natürlich all das menschliche Zubehör, das mit auf einer Burg, unterhalb einer Burg und um eine Burg herum siedelt, all die sich anlagernden Schuster, Schmiede und Schirrmacher, Weber, Krämer, Küfer und Töpfer, wie man sie aus Mittelalterfantasyfilmen kennt. Doch die meisten Bürger haben überhaupt nichts mit einer solchen Burg im Sinne eines herrschaftlichen Festungsbaues zu tun. Die „Burg“ bezeichnet ursprünglich nicht nur den Wohnsitz eines Burgherrn, mit Palas, Bergfried und Kemenate, sondern auch die befestigte Wohnstätte einer munizipalen Gemeinschaft, also die mit einer Mauer umgebene Ortschaft, die ihren Einwohnern Schutz bietet, zu deutsch: die Stadt. Ein Bürger ist also zunächst mal jemand, der sich „birgt“. Er findet „Bergung“ innerhalb der Mauern einer befestigten, eventuell auch burgüberthronten Stadt, hinter der Bewachung durch das militärische Personal. Wäre die Sprachgeschichte etwas anders verlaufen, könnte der „Bürger“ auch ein „Berger“ sein, vielleicht sogar ein „Verberger“. Aber damit kommen wir nun doch etwas vom Wege ab …
Wir wollen uns hier aber ohnehin nicht dem gesamten Evolutionsweg des Homo Burgensis widmen, wir wollen vielmehr nach diesem flüchtigen Blick auf seinen Anfang direkt einen eingehenderen Blick auf das Stadium seiner maximalen Ausgereiftheit, seiner vollen Prachtentfaltung werfen.
Diese Phase reicht vom revolutionären Ende des 18. Jahrhunderts bis ziemlich genau ins Jahr 1968. Wir reizen das Zeitfenster mit guten Gründen so weit aus, trotz der Einschübe monströser Unbürgerlichkeit, trotz der mehrfachen Verhunzung und Selbstdemontage des Bürgertums. Denn das Versagen, die unsterbliche Schande, war immerhin noch ein Versagen mit schlechtem Gewissen. Man hatte zumindest ein letztes Gefühl dafür, dass man seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt hatte, dass man sich vor der Vergangenheit und der Zukunft bis ins Mark blamiert hatte. Vor allem natürlich durch die Jahre des Nationalsozialismus. Dann aber auch durch die Wiederaufbau- und Wirtschaftswunderzeit, die nur noch eine letzte, slapstickhaft verspießerte Version von Bürgerlichkeit hervorbrachte. Nachdem Hitler die Bürger in eine Hölle aus hemmungsloser Niedertracht und blutigem Sündenrausch gelockt hatte, baute ein wohlgenährter Heinz Erhardt sie noch mal zu finaler Gemütlichkeit auf, indem er ihnen kichernd kalte Platten, süßen Wein und Herrenwitze servierte.
Aber die Bürger, die besseren unter ihnen, genierten sich hier und da zumindest noch ein wenig über ihre Geistesabwesenheit, ihre Feigheit und ihre anschließende Seichtheit. Sie kannten noch die Namen und die Gesichter derer, die sich nicht arrangiert hatten, die emigriert waren, nach innen und außen, die etwas riskiert und geopfert hatten, und sie ahnten irgendwo im Innern, was sie selbst hätten tun können und eigentlich hätten tun müssen, wie sie eigentlich hätten sein müssen. Es gab ja damals noch etwas Eigentliches.
Das änderte sich radikal mit dem Kulturbruch von 1968.
Die Achtundsechziger und ihre Kinder zogen aus dem Versagen des Bürgertums die Konsequenz der totalen Un- und Antibürgerlichkeit. Das war gar nicht so abwegig. Seltsam war jedoch die schroffe Einseitigkeit. Unbürgerlich hätte ja auch bedeuten können: adelig, aristokratisch, heroisch-herrenmenschlich. Denn immerhin waren es zu einem sehr großen Teil die Adligen, die den Widerstand gegen Hitler betrieben und mit dem Leben bezahlt hatten. Statt aber nun zu schließen: „wir müssen alle mehr sein wie Stauffenberg und Tresckow, wie Kleist und Moltke“, wollte man lieber sein wie irgendwelche bohemischen Luftpumpen und Nichtsnutze. Man wollte kiffen und ficken und rumlungern, man wollte schnodderig und unpünktlich und ineffizient sein, und meinte, das würde dann gegen irgendwelche neuen Faschisten schon reichen. Tat es ja auch, muss man durchaus zugeben. Aber es hatte seinen Preis, all die deutsch-bürgerlichen Sekundärtugenden, mit denen sich bekanntlich auch KZs und Vernichtungslager bestens hatten betreiben lassen, über Bord zu schmeißen.
Man konnte jeden künftigen Nazismus verhindern, indem man Rainer Langhans wurde. Eine Gesellschaft aus Langhansens würde nie mehr einen Nährboden bieten für Ideologien, die Strammheit, Gehorsam und Kraft durch Freude unters Volk bringen wollten. Mit Rainer und Uschi, mit Kunzelmann und Teufel war Strammheit – jedenfalls im Sinne der Riefenstahl-Ästhetik – kaum zu machen.
Die Tragweite dieser vorsätzlich einseitigen Formverweigerung, dieser maximal gründlichen Hitlerprophylaxe durch Abschlaffung und Amorphie, spüren wir erst heute so richtig. Das Volk, dessen Jugend nach des Führers Wunsch zu Wieseln und Windhunden herangezüchtet werden sollte, degeneriert vor unseren Augen mehr und mehr zu einem dösig herumsumpfenden Schwarm von Quallen und Amöben. Gechillten und antiautoritären Quallen zwar, die endgültig keinem faschistischen Rattenfänger mehr nachlaufen würden, aber halt Quallen. Gallertartigen Klumpen, die niemandem nachlaufen könnten, selbst wenn sie es wollten.
Ich glaube, mir wären Ratten lieber, oder Wiesel oder irgendwelche anderen metaphorischen Viecher, die einem Führer wenigstens nachlaufen könnten, es aber aus guten Gründen und vor allem aus innerer Stärke und Selbstachtung nicht tun.
2. Wie man einen Papst hereinbittet
Das eigentliche Problem von 68 ist wohl, dass eine romantische Bewegung, eine musikalische Umstimmung der Zeit, von einer politischen, vielleicht nur einer pseudopolitischen, in Wahrheit vor allem ideologischen Parallelbewegung übertönt wurde.
Marxistische Soziologen und solche, die es werden wollten, haben das Suchen und das Summen der Blumen-, der Sonnenkinder verhunzt und für ihre dilettantischen, theoretischen Brutalitäten gekapert.
Gitarrenträumereien, nacktes Getänzel im Gegenlicht, junge Regungen und Rührungen und Schwingungen, gelöste, aufbrechende Vitalität – ich verstehe den unbürgerlich-lebensreformerischen Impuls dieser Generation, ich fühle zutiefst Heimatliches in all den Bildern und Liedern, ich höre meine älteren Brüder und Schwestern erzählen und singen. Ich hätte einer von ihnen sein können. Aber dann kommen Dutschke und Krahl und Cohn-Bendit, dann kommen all diese universitär verbiesterten Mao-Apologeten und jede Musik verstummt – eckige Krämpfe, Sätze von Papier und Beton, soziologisches Plastik im Neonlicht hellgrauer Seminare. Brillen und Arroganz. Verhältnisse, Bedingungen, Systeme, Kämpfe, Massen, Organisationen, Bewusstseine, Flugblätter, Kommunen, Räte, mörderische Weltverbesserung. Und mit all dem kommen Meins und Baader und Bommi und Ennslin und Meinhof und machen mit ihrem Gelaber und Geballer endgültig alles kaputt.
Das Schlimme aber ist, dass sich all die Agitatoren und Utopisten, die Hörsaal-Provokateure und zukünftigen Studienräte, die Lifestyle-Leninisten und Bonnie-und-Clyde-Imitatoren, all diese Schwätzer und Verbrecher letztlich durchgesetzt haben. Dass sie im Gedächtnis geblieben oder durch die Institutionen marschiert sind und die Hegemonie eines Zeitgeistes erkämpft haben, der noch immer mächtig und tonangebend ist. Während die Romantiker sang- und klanglos ausgestorben sind.
Nebenbei: Stilistische Kleinigkeiten sind wichtig, mindestens erhellend. Das Unmusikalische, das gänzlich Gefühl- und Gespürlose linker Ideologen bezeugt beispielsweise der Name, den Dutschke seinem Sohn gab: Hosea-Che.
Hosea-Che Dutschke – ein Klang wie ein mit Oblaten gefüllter Sitzsack in Form eines rostigen Panzers. Oder ein Quietscheentchen mit Altem Testament und Maschinengewehr. Eine mit Stacheldraht gefüllte Gummizelle. Etwas in der Art.
Leuten, die in ästhetischen Fragen derart versagen, sollte man nicht zutrauen, dass sie in sozialen, politischen, staatskritischen Dingen irgendwas zustande bringen.
Jetzt aber in allem Ernst: Was war nun der Bürger vor der Kulturrevolution von 1968, vor der Barbarei von 1933, vor dem Ende der alten Welt im Jahre 1914? Was ist ein Bürger nach Anspruch und Idealvorstellung?
Der Bürger in seiner ungebrochenen, unverzerrten, unparodistischen Erscheinungsform ist – so allgemein wie möglich gesprochen – die Verkörperung bestimmter habitueller Grundorientierungen, sein Daseinsmuster ist gekennzeichnet durch eine charakteristische Energieverteilung, eine Struktur mentaler Richtungen und lebenspraktischer Verdichtungen.
Entspannung ist das Leitmotiv im gesellschaftlichen Klima seit 68. Entspannung, Lockerheit, Lässigkeit, Coolness, Informalität. Wert und Dringlichkeit der Entspannung weisen auf das hin, was vorher offenbar im Übermaß vorhanden war und nun überwunden sein wollte: Spannung. Die Menschen waren gespannt, angespannt, womöglich verspannt und überspannt. Wir sind geneigt, es für fraglos ausgemacht zu halten, dass Spannung – abseits von Thrillern und Krimis – etwas Unzukömmliches sei, etwas, das die Menschen stresst, krankmacht und letztlich in den Herzinfarkt treibt. Spannung und Stress sind aber verschiedene, vielleicht sogar völlig entgegengesetzte Arten, den Menschen zu energetisieren. Ganz simpel könnte man sagen: Spannung richtet den Menschen auf, Stress drückt ihn nieder. Spannung macht ihn wach und aufmerksam, Stress hetzt ihn kurzfristig auf und deprimiert ihn langfristig.
Entspannung lässt ihn in beiden Fällen erschlaffen und in sich zusammensinken. Während der gespannte Mensch aber nur zu einem gewissen gesunden Niveau von Gelöstheit in die Relaxation zurückfällt, zerfließt der Gestresste geradezu haltlos bis zur Amorphie. Der Spannungsmensch macht einen erholsamen Mittagsschlaf, aus dem er gestärkt wieder aufsteht, Hemd und Schuhe anzieht und sich wieder ans Werk macht. Der Stressmensch gammelt in Joggingklamotten auf der Couch herum und betäubt sich so lange mit entspannenden Serien und Talkshows, bis der Druck der Verhältnisse ihn irgendwann des Morgens wieder in seine Berufsverkleidung zwingt.
Ich will diesen Befund nicht überstrapazieren, ich will nur andeuten, dass der alte, der bürgerliche Mensch in der Regel wohl unentspannter war, was aber durchaus ein Vorteil gewesen sein kann, da es der dem Menschen innewohnenden Tendenz zur Formschwäche erfolgreich entgegenwirkte. Man gestattete sich keine Dauerentspannung, es gab Kräfte, Zugkräfte, Ziele, soziale, psychische Vektoren, die einen auf Spannung hielten.
An erster Stelle sind hier Selbstachtung und soziale Kontrolle zu nennen. Man war darauf vorbereitet, jederzeit gesehen zu werden. Diese Grundierung des Lebensgefühls verhinderte, dass man auf ein Niveau unvorzeigbarer Verwahrlosung regredierte. Es konnte an der Tür klopfen, dann musste man diese Tür öffnen können und einen Nachbarn, ein Fernsehteam oder einen Papst hereinbitten können, ohne sich total zu blamieren. Man musste nicht allzeit in Frack und Zylinder bereitstehen, aber in Joggingbuxe und Unterhemd vor dem Fernseher rumzugammeln wäre etwa einem Golo Mann wohl niemals in den Sinn gekommen.
Nie durfte die Spannung so weit abfallen, dass man nicht mit ein paar Handgriffen vor den Augen der Welt hätte bestehen können. Was nach einem unerfüllbaren Anspruch klingt, klingt nur für uns Heutige so. Für den Bürger von ehedem waren die Augen der Welt fast identisch mit dem eigenen Blick.
3. Der Mensch kann sich nicht täglich neu zu allem entschließen
Das Hochgefühl, Subjekt eines eigenen Lebens zu sein, das keiner Rechtfertigung bedarf, hat nicht erst die Generationen nach 68 erfasst, man kannte das auch schon vorher, aber längst nicht in dem Grad, wie er uns heute selbstverständlich erscheint. Der geheiligte Individualismus hat sich zu einem die Gesellschaft atomisierenden Egozentrismus ausgeweitet, der uns völlig normal vorkommt. Klar, findet man Gier, Eigennutz, Abkapselung und Ellenbogenmentalität nicht so gut, aber dass der Mensch ein selbstbestimmtes Leben führen soll, das zieht niemand in Zweifel. Dass es größere, wichtigere Instanzen außerhalb, oberhalb des Selbst geben könnte, die unser Leben bestimmen sollen, erscheint uns spontan gefährlich, kollektivistisch, totalitär.
Wie in so vieler so hat auch in dieser Hinsicht Hitler ganze Arbeit geleistet, wenn er uns das Gemeinschaftsgefühl, das Aufgehobensein in einem Personenverband, der die Existenz des Einzelnen umfängt, mit höherem Sinn und sozialer Wärme belebt, für immer ungenießbar gemacht hat. „Du bist nichts, dein Volk ist alles“, lautet die extremistische Pervertierung einer Selbstverständlichkeit, die uns fortan fremd und verdächtig werden musste. Dass du etwas bist, und dein Volk auch etwas ist, klingt für heutige Ohren schon wie eine Zumutung. Diese Zumutung aber ist im Grunde genau das, was für den Bürger das Behagen des Lebens ausmacht. Man kann hier den Begriff des Volkes getrost weglassen, man sollte es auch, nicht, weil er anrüchig wäre, sondern weil er nicht recht passt für das, was gemeint ist. Gemeint ist das Gemeinwesen, und das ist eine nationale ebenso wie eine städtische Veranstaltung.
Das Gemeinwesen ist die Imago, der ausgebildete Ziel-Organismus der Zivilisation. Zivilisation ist der Prozess, der aus Menschen als Naturwesen Glieder eines politischen Großkörpers macht. Aus Homines Sapientes werden Cives: Bürger. Teilhaber und Gestalter einer Polis.
Nicht jedes menschliche Großkollektiv ist ein Gemeinwesen. Die Mitglieder eines Amazonasstammes sind wohl eher keine Cives. Sehr wohl aber sind sie kultiviert. Sie besitzen eine in sich voll gültige, eigenständige Kultur. Wenn man sagt, sie seien nicht mehr ursprünglich und archaisch, sondern durchaus von „der Zivilisation“ berührt, dann müsste man eigentlich sagen: Sie sind berührt von den technischen und kulturellen Errungenschaften der westlichen zivilisierten Gemeinwesen. Wenn man den Yanomami ein paar I-Phones und ein paar Nike-Schuhe vor die Hütten legt, dann hat das jedoch mit Zivilisation noch nicht viel zu tun.
Das zivilisierte Gemeinwesen hat idealerweise Strukturen ausgebildet, die die Gestaltungs- und Erhaltungskräfte des Einzelnen erheblich überragen: die sogenannten Institutionen, welche das Gemeinwesen in seiner Identität und Funktionalität weitestgehend bewahren, auch wenn nach biologischem Turnus etwa alle hundert Jahre kein einziges Individuum einer Kohorte mehr am Leben ist.
Die Anerkennung dauerhafter Einrichtungen, die Befürwortung der geordneten Gewalt und der gemeinschaftsdienlichen Beschränkung individueller Freiheiten, kurz: das Vertrauen in die Institutionen und das Engagement in diesen Institutionen macht einen großen Teil der ethischen Seite des Bürgertums aus. Der Bürger – im Gegensatz zum lässigen, lockeren, „unverspießerten“ Fürsprecher von Libertinage und permanenter Aushandlung – weiß, dass der Mensch sich nicht täglich neu zu allem entschließen kann. Dass er sich Routinen und Regeln unterwerfen muss, die im besten Falle natürlich genau dem entsprechen, was er in klaren, bewussten Momenten ohnehin will und von sich verlangt. Wäre es anders, wären die Regeln zu einem nennenswerten Anteil seinen intrinsischen Motiven, seinem Willen, seiner Natur entgegengesetzt, so würde er unweigerlich krank, und wenn die Krankheit ihm nicht zum Ausstieg aus dem falsch, das heißt unmenschlich geregelten Alltag verhülfe, ginge er bald zugrunde. (Was ja in der Realität auch häufig genug passiert. Aber hier geht es ja vor allem um das Ideal.)
Das Regelgerüst soll dem Menschen letztlich nur helfen bei dem, was er ohnehin freiwillig tun würde und nur deshalb hin und wieder unterlässt, weil die Freiwilligkeit mit der Faulheit oder dem Wetter oder dem Fernsehprogramm kollidiert.
4. Paranoia und Leistungsethik
Unsere heutige Gesellschaft tendiert sichtlich in Richtung allumfassender Anomie. Anomie bedeutet Gesetzlosigkeit. Nicht so sehr im juristischen Sinne, denn Gesetze haben wir zweifellos genug. Es geht eher um die tausenden von Regeln des Zusammenlebens, die sich von selbst verstehen müssen, damit ein Gemeinwesen funktioniert. Oder zumindest um die Akzeptanz von Autoritäten, denen man zugesteht, dass sie die Geltung der Regeln im Ernstfall erzwingen dürfen.
Ich denke dabei nicht einmal an Polizei und Beugehaft, Ordnungsamt und Steuereintreiber, sondern zum Beispiel an Lehrer. An deutschen Schulen herrscht im Jahre 2020 faktisch ein Zustand der Anomie. Ein Pädagoge, der nicht mit natürlicher Autorität, einer charismatischen Ausstrahlung, einer respektgebietenden Stimme oder Körperlichkeit gesegnet ist, hat keine Chance, irgendetwas gegen Schüler auszurichten, die schlicht sagen: „Lass mich in Ruhe, du kannst mir gar nix.“ Denn sie haben ja Recht. Der Lehrer kann ihnen gar nix.
Ein Lehrer, der heute noch etwas ausrichten will, müsste einer sein, von dem man geliebt werden will, von dem man aber gleichzeitig weiß, dass er die innere Stärke und die Sprachmacht hat, einen psychisch vor der Klasse zu vernichten. Und im besten Fall hätte er auch noch die körperliche Kraft, es auf eine physische Konfrontation ankommen zu lassen.
Ein Lehrer, hinter dem keinerlei institutionelle Macht mehr steht, muss selber diese Macht sein. Er muss potentiell das Leben eines Schülers zerstören können*, mit Worten, mit Blicken, mit Fäusten. Er kann sich nicht auf irgendwelche Eltern, auf den Rektor, auf die Polizei, auf die Politik verlassen. Familie, Schule und Staat haben ihre Regelwerke über Bord geworfen und lassen sich treiben in träge schwappender, lauwarmer Anomie.
Ich habe mächtige Lehrer, natürliche Autoritäten kennengelernt. Es waren nicht die sympathischsten. Aber es waren die, die wir heute noch dringender bräuchten als zu meiner Zeit, wenn irgendetwas übrigbleiben soll vom bürgerlichen Gemeinwesen.
Es gab eine Anzahl von Pädagogen, die psychisch stark waren, die sich einzelne Schüler vorknöpfen konnten und sie durch Blicke, durch minutenlanges bloßes Fixieren so weit vorführen konnten, dass man kurz vorm Heulen war. Auch damals gab es schon Fälle, die durch solche Maßnahmen nicht zu bändigen waren, die dann erst recht rumschrien, wutentbrannt aus der Klasse stürmten und die Tür hinter sich zuschlugen. Einen Lehrer aber gab es, bei dem es nie einen solchen Vorfall gab, nie ein lautes Wort, nie eine Respektlosigkeit. Das war jemand, der außer Eloquenz und mentaler Stärke auch Körperkraft und Karatekünste aufzubieten hatte. Natürlich wusste man, dass der einen nie anrühren würde, aber das Wissen, dass er einen in wirklich jeder Hinsicht vernichten konnte, war im besten Sinne ehrfurchtgebietend.
Diese Ehrfurcht aber sollte in funktionierenden Zivilisationen nicht Personen, sondern Institutionen gelten.
Die maßgebliche Institution der bürgerlichen Lebensform war die Familie, und mit der Anerkennung dieser halb naturlogischen, halb kulturwillentlichen Einrichtung ging eine Selbstachtung einher, die stolz Ja sagte zum Herkommen, zur Tradition, Verwurzelung, Überlieferung, zur Verantwortung des Bewahrens und produktiv-liebevollen Erneuerns. Mitunter mochte es auch ein zähneknirschendes Ja sein, ein verzweifeltes oder verlegenes, aber es war ein Ja in dem Wissen, dass vor einem und nach einem etwas war und nicht nichts. Ein Etwas, vor dem man irgendwie zu bestehen und sich zu rechtfertigen hatte. Die kritische Galerie der Ahnen und Nachfahren.
Dieser tadelnde, stirnrunzelnde Spuk, und mit ihm die autopädagogische Paranoia, dass die eigene Existenz gesehen, bewertet und beurteilt, im schlimmsten Fall verurteilt wird, dieses Selfmonitoring, dem alle Leistungsethik entstammt, führt in den Bereich, wo das Bürgerliche seine Prägungen durch das Christliche offenbart. Kein Bürger ohne Jenseits, kein Bürger ohne Gott. Und wenn das Bürgertum auch die Gotteskritik, die Gottesgegnerschaft hervorgebracht hat, so gab es doch kein Bürgertum, in dem der Christengott und seine Gebote, vor allem aber sein Kirchenvolk und seine irdische Beamtenschaft keine Rolle gespielt hätten. Das Stammhaus der Buddenbrooks steht im Schatten der Marienkirche. Es kann nicht neben einer kambodschanischen Tempelanlage oder einer Maya-Pyramide stehen. Auch nicht neben einer arabischen Moschee.
Der Bürger ist ein Produkt der abendländischen Stadt, in deren Mitte eine mächtige Kirche steht. Und, etwas abseits der Mitte, eine Synagoge.
5. Die Welt vergessen
Was außerdem das Bürgertum ausmacht, kann man am besten nachlesen bei einem, der es wissen muss; ich fasse hier lediglich in Stichworten noch kurz zusammen, was Joachim Fest (was für ein mustergültiger, nahezu romanhafter Bürgername!) in abgeklärt-melancholischen, feierlich-nachdenklichen Sätzen vor vierzig Jahren bereits ausgeführt hat:
Regelmäßigkeit. Pflichttreue und Beharrlichkeit dem gegenüber, was getan werden muss, ohne Rücksicht auf Laune und Tagesform. Selbstbeherrschung, zur Not auch Selbstquälerei. Fügung in die rituelle Ordnung des Lebens, ins Zyklische. Leistungswille, Wille zum Exzellieren. Sinn für individuellen Rang, Bekenntnis zu menschlichen Unterschieden. Talent zur Bewunderung, Faszination durch das Einzigartige. Gedanke der Vervollkommnung, der erzieherische, der selbsterzieherische Zug, Neigung zu Kritik und Selbstkritik. Die Idee der Verantwortung des Menschen und seiner Befreiung durch sich selbst. Hunger nach geistigen Erfahrungen, Leidenschaft für die Teilhabe an der Kultur, gepaart mit der flagellantisch-produktiven Passion für den Kulturpessimismus. Wirklichkeitssinn, Zuverlässigkeit, Zurückstellung persönlicher Interessen, Dienst am Bestand des Ganzen.
Wenn es eben hieß: „die maßgebliche Institution der bürgerlichen Lebensform war die Familie“, dann ist die Vergangenheitsform leider sehr angebracht und ganz absichtlich so gewählt.
Alle Kräfte der Gegenwart wirken gegen die Familie, gegen die Institutionen überhaupt, gegen alte Ordnungen, bewährte Maße, erprobte Erfolgsmodelle, tradierte Relationen und Entitäten.
In einer Welt, die sich täglich weiter einer Dystopie des Konsumismus, des Globalismus, des Digitalismus, des Porno-Prollo-Empörungs-Amüsements, des verwilderten Multikulturalismus und der hemmungslosen Pöbelherrschaft anverwandelt, kommt das Konzept der Bürgerlichkeit an ein zwangsläufiges Ende. Es ist – höchstwahrscheinlich – für immer aus mit dem Bürgertum.
Dass wir uns hier dennoch mit diesen verendenden Dingen beschäftigen, beruht wohl auf der verschwindend minimalen Restwahrscheinlichkeit, dass irgendetwas Großes, Grundstürzendes, Weltrevolutionäres passieren könnte, durch das sich alles noch mal ändert. Irgendwas mit Außerirdischen, mit Meteoren oder Seuchen oder Maschinenherrschaft, künstlicher Intelligenz oder besser noch: künstlicher Vernunft.
Aber ernsthaft: Gibt es irgendeine Möglichkeit, mit irdischen Mitteln, mit menschlicher Vernunft noch irgendetwas auszurichten?
Die abendländische Bürgerlichkeit war eine der balanciertesten und produktivsten menschlichen Lebensformen, die wahrscheinlich kulturmenschlichste, die unsere immer noch halbtierische Spezies bislang hervorgebracht hat. Aber sie konnte nur gedeihen, weil es für sie eine Umwelt gab, die sie auch zuließ. Eine Umwelt innerhalb eines Burgwalls, bildhaft gesprochen; einer Stadtmauer, die sie vor der Welt schützte.
Das Bürgertum braucht diesen Schutz, es braucht einen Staat, der die Bürgerlichkeit langfristig sichert, der ein Klima des Vertrauens und Behagens aufrechterhalten kann, in dem der Bürger „die Welt“ (mindestens zeitweise) vergessen kann, und sich innerhalb seiner „Umwelt“ seinem Lebenswerk widmen kann. Seinem Unternehmen, seiner Kulturaufgabe, seinem Amt, seiner Familie, seinem Handwerk, seiner Repräsentation, seiner Ordnung, seinem schönen, gemeinwohlorientierten Leben.
Diese Zeiten scheinen vorerst vorbei zu sein. Der Staat – der deutsche zumindest und viele weitere westliche mit ihm – ist beinahe am Ende. Andere Akteure haben längst den Abbau von Macht, Gewalt, Gestaltungskraft und Gestaltungswillen so weit vorangetrieben, dass dem illusionslosen Beobachter eine Restitutio ad integrum nur durch Putsch- und Kriegsaktionen denkbar scheint. In düsteren Momenten zumindest.
Wer das nicht will, aber auch nicht aus der Düsternis heraus untätig zusehen will, muss sich radikalisieren. Radikalisieren heißt hier: Alles neu denken. Alles von Grund auf neu durcharbeiten, bewerten, kritisieren, ordnen, aussortieren, neu sehen, neu auf sich wirken lassen.
Der radikale Bürger muss die totale Konsequenz einfordern. Die altbürgerliche Mäßigung, die Zurückhaltung und Contenance, die Zügelung der Affekte, die Konzilianz gegenüber dem Gegner grenzt unter den Bedingungen der Gegenwart immer öfter an Verantwortungslosigkeit. Das ist unschön, aber so ist die neue Zeit.
Ich wünschte, wir könnten uns wie gesittete Menschen miteinander ins Benehmen setzen, ich wünschte, wir könnten gepflegt, respekt- und würdevoll miteinander streiten, die Formen wahren und im Andern eine konkurrierende Meinung oder Weltanschauung erblicken, die besonnen zu diskutieren wäre, aber keinen Feind, der unschädlich gemacht werden muss, keinen Patienten, der kuriert werden muss. Ich wünschte, wir könnten sein wie Fontane, Hofmannsthal, Thomas Mann, Golo Mann, Joachim Fest. Aber es ist dies wohl nicht die Zeit mehr für Vornehmheit, für maßvoll-manierliche Mahnungen abseits der Gemeinheit. Appell und Appeasement haben sich selten bewährt in Zeiten von Glaubenskrieg und Kollektivwahn.
Joachim Fest, der mutmaßlich letzte Bürger alten Stils, warnte gelegentlich vor den Intellektuellen, weil die immer für die radikalen Lösungen einträten. Ich weiß nicht genau, ob ich ein Intellektueller bin … als jemand, der den ganzen Tag zwischen seinen Bücherregalen herumsitzt und sich den Kopf zerbricht, und dieses Zerbrechen in lesbaren Sätzen festzuhalten versucht, bin ich wahrscheinlich so einer … jedenfalls, ja: Ich bin für radikale Lösungen. Unbedingt!
„Radikal“ heißt aber – man muss solches Sekundarstufenwissen heute leider der Unmissverständlichkeit halber immer mal wieder in Erinnerung rufen – „radikal“ heißt nicht: extremistisch, verbrecherisch, verfassungsfeindlich, gewalttätig oder terroristisch.
„Radikal“ heißt: nicht an Symptomen herumdoktern, sondern das Übel an der Wurzel packen. Den Tumor nicht überschminken, sondern fachgerecht herausschneiden, den Keim des Verderbens vollständig eradizieren. Einem Chirurgen, der nicht radikal ist, sollte man sich besser nicht anvertrauen.
Der Radikale arbeitet – metaphorisch – mit Tomograph und Skalpell. Der Extremist arbeitet – metaphorisch und real – mit Sprengstoff und Maschinenpistole.
6. Wie schaffen wir es?
Bevor ich jedoch für radikale Lösungen eintrete, wäre ich dafür, die zu lösenden Probleme erst einmal explizit zu benennen und die richtigen, die radikalen Fragen zu stellen:
Wie schaffen wir es, die Grenzen des Gemeinwesens so zu definieren, dass Bürgerlichkeit wieder gedeihen kann? Und wo nehmen wir die Härte her, diese Grenzen konsequent zu verteidigen?
Wie identifizieren wir die inneren Gefährder des Gemeinwesens (zumal, wenn sich – wie im Falle der Altparteien – alle für die Bewahrer desselben halten), und was – im Ernst – machen wir mit ihnen?
Wie schaffen wir es, den äußeren Gefährdungen des Gemeinwesens, allen voran der explosiven Vermehrung der Erdbevölkerung human zu begegnen und gleichzeitig die unheilvolle Entwicklung schnellstens umzukehren? Wie schaffen wir es, die Population des Planeten auf einem vernünftigen Niveau – also vielleicht etwa zwei Milliarden – zu stabilisieren?
Wie schaffen wir es, den Menschen einen Lebenssinn jenseits von Erregung und Unterhaltung zu vermitteln, ihnen Ziele jenseits von Verbrauch, Besitz, Erfolg, Spaß, Eigennutz, Beachtung und Beifall ans Herz zu legen?
Wie schaffen wir es, „die Medien“ zu einer Kraft zu machen, die der Rationalisierung der öffentlichen Auseinandersetzung dient, der vernünftigen Verständigung, der maßvollen und gemeinwohlorientierten Debatte? Und wie hindern wir diejenigen, die lügen, hetzen, aufstacheln, diejenigen, die das Volk verblöden, verpöbeln, dehumanisieren wollen, ihr destruktives Treiben fortzusetzen?
Wie schaffen wir es, die Menschen zu befreien, sie wirklich zur Freiheit, zur Selbstbestimmtheit, zur Reflexivität, zur Verantwortlichkeit zu befähigen, und sie trotzdem in überindividuelle Ordnungen und größere Strukturen einzufügen?
Wie schaffen wir es, Europa in einen zugleich progressiven wie konservierenden Kulturraum zu transformieren, einen in jedem Wortsinn „Topos“ abendländischen Menschentums?
Wie schaffen wir es, den Willen zur Kultur in den Menschen zu stärken und die zerstörerische Konsumsucht zu heilen.
Wie schaffen wir es, die Wiederverzauberung der Welt ins Werk zu setzen, ohne ein bloßes Lügengebilde, eine künstlich-illusorische Scheinwelt zu errichten?
Das sind Fragen für mehrere Bücher, für mehrere Leben wohl gar. Und für Gehirne, die leistungsfähiger sind als das, welchem man hier gerade beim Grübeln und Brüten zusehen kann. Ich will daher nur auf einen Punkt noch annäherungsweise eingehen, für den ich als meditierender Müßiggänger mich einigermaßen zuständig fühle.
7. Der wahre Kulturschaffende
Der Künstler kann nicht anders, als künstlerisch auf das Leben, die Menschen, die Welt zu blicken. Es gibt mehr als genug Ansätze, welche die wirtschaftlichen, rechtlichen, religiösen, die sicherheits-, ordnungs-, bildungs-, finanz-, umwelt- oder sozialpolitischen Aspekte in den Vordergrund stellen. Insofern kann es nicht schaden, auf das hinzuweisen, was für den „ästhetischen Fundamentalisten“, den radikalen Kultur- und Geistesmenschen das Entscheidende ist: Das Leben als Kunstwerk.
Die Menschen können nicht sämtlich zu Malern, Musikern, Dichtern werden, aber sie können ihr Leben als Werk begreifen. Das Leben als Kunstwerk, überhaupt als eine Art von Werk, als eine Art von Sehenswürdigkeit – das müsste Kernvorstellung und Leitbild eines kulturtragenden Bürgertums sein. Und ich glaube, dass diese Vorstellung noch vielen Heutigen – wenn sie mit sich und ihren Gedanken allein sind – gar nicht so fremd ist. Ich glaube, fast jeder kennt diese Vorstellung, lebt geradezu in dieser Vorstellung, dass er am Ende auf etwas zurückblicken will, das mehr war als eine Liste von Ferien, Liebschaften und Gehaltserhöhungen. Wir wollen auf etwas Sinnvolles, etwas Gerundetes und Stimmiges zurückblicken, auf etwas, das sich sehen lassen kann, vielleicht sogar auf etwas Beispielgebendes und Nachahmenswertes und Weiterwirkendes.
Die Idee vom „Leben als Werk“ lässt ein völlig anderes Ideal aufscheinen als das gegenwärtige Streben nach einem „Leben als Konsumfest“. Das Ideal, das Wirtschaft, Werbung und Trash-Medien der Masse heute einpflanzen wollen, ist der erfolgreiche Performer und Genießer, der ausgesorgt hat und ewig Luxusurlaub machen kann.
Der Mensch, der sein Leben als Werk sieht, ist das genaue Gegenteil davon. Er genießt wohl auch, aber erstens mit Maß, zweitens unter dem Gebot der Neidvermeidung und drittens in Formen, die zum Nachahmen anregen, die „sozialverträglich“ und präsentabel sind, die den goldbehangenen Prahlhans als den kindischen und asozialen Pöbel decouvrieren, der er ist.
Aber – auch wenn es durchaus Schnittmengen gibt – wir reden hier nicht von irgendeinem Adel, der Kulturmensch ist ganz wesentlich Bürger. Er ist vornehm, aber nicht in dem äußerlichen Sinne vornehm, wie es ein karikaturhafter Aristokrat mit geziert abgespreiztem Finger wäre, sondern in seiner bis ins Innerste durchgeformten Haltung. Dieser Mensch verhält sich hinter verschlossenen Türen, wenn keiner zusieht, genauso wie im Verkehr mit seinen Mitbürgern, seine Selbstachtung steht immer im Einklang mit der Achtung des Größeren, dem er dient, dem Gemeinwesen. Seine Ethik ist seine Ästhetik.
Eine solche Bürgerlichkeit höbe im Idealfall jede Elite auf. Jeder echte Bürger wäre prinzipiell willens und fähig, als Abgeordneter oder Amtsträger zu fungieren und als solcher zeitweise die Interessen des Ganzen zu vertreten.
Aber der Idealfall steht hier mit Recht im Konjunktiv, denn es wäre ein langer, mit lauter Unwahrscheinlichkeiten gepflasterter Weg zurückzulegen, bis so ein Ideal erreicht wäre. Auf diesem Weg müsste eine Avantgarde vorangehen, eine – eben doch – Elite, eine provisorische Elite von radikal Unzeitgemäßen, die durch ihr Leben ein Beispiel geben und das schüchterne, in der Keimruhe harrende Bürgertum aufrütteln, nachziehen und mitreißen.
Was legitimiert diese Elite, und wer wählt sie aus? Nichts und niemand. Darin liegt das Risiko. Das Risiko einer jeden Zurückweisung der konventionellen Realität. Das Abenteuer, das in jeder Anmaßung und regelwidrigen Selbstermächtigung liegt. Das Wagnis, das jeder „moralische Selfmademan“ (Dolf Sternberger) eingeht, der aus den herrschenden Prozessen aussteigt und zum Sprung in eine neue Wirklichkeit ansetzt. Der radikale Bürger reformiert nicht, er revolutioniert nicht einmal. Er negiert die Welt, wie sie gerade noch war, vergisst sie und gründet auf dem einst schon Erreichten eine neue.
Nichts überzeugt so sehr wie das Faktische, das fraglos Dastehende. Der tatsächliche Bürger, der dasteht, als wäre er nie anders denkbar gewesen, ist der wahre Kulturschaffende – wenn dieses nach Politbüro und Zentralkomitee müffelnde Wort ausnahmsweise gestattet ist. Aber er ist „Kulturschaffender“ im totalen Gegensatz zu denen, die sich heute wieder selbst so nennen. Er schafft die Kultur auch nicht vorsätzlich, indem er sozialkritischen Politkitsch auf Bühnen bringt oder indem er Leinwände mit Exkrementen bepinselt oder indem er zeitgeistgetreue Manifeste verfasst, sondern einfach so nebenher. Indem er sein Leben lebt, seinen Pflichten nachkommt und sein ganzes Dasein in jenen vorbildlichen Formen entfaltet, die ihm die natürlichen sind. Er muss kein Heiligenleben führen, sondern ein ästhetisch vorzeigbares Leben. Jeder, der ihm zusieht bei seinem Leben – und man kann ihm zusehen, denn er ist präsent in seiner Stadt, er ist sichtbar in seiner Gemeinde, er ist publik und populär in seinem Volk –, sieht, dass ein Leben so sein muss, so im Einklang mit den Werten und Idealen eines souveränen, humanen Menschentums, das sich freigemacht hat von aller ideologischen Enge und Verbissenheit. Ein Leben, das die Spielregeln des Zeitgeistes nicht nur verneint, sondern gar nicht mehr kennt. Dieser Mensch spielt nicht mehr, er lebt wirklich, als Erwachsener unter Kindern. Kindern, die ohne ihre Spielzeuge immer nichts anzufangen wussten mit ihrer Zeit und ihrer Welt. Aber jetzt wachen sie auf, wachsen heran, erblicken verlegen die bunten, blinkenden Zeitvertreibe in ihren Händen, werfen sie in die Ecke und verlangen nach den echten Dingen des Lebens, nach Ausrüstung und Einrichtung für die große und schöne Welt jenseits der Täuschungen und Ersatzbefriedigungen. Die Stadt jenseits der Einkaufszentren. Den Lebensraum jenseits der digitalen Maschinen. Die Geselligkeit jenseits der Netzwerke. Den Genuss jenseits von Trost und Ablenkung. Die Arbeit jenseits von Zeitverschwendung. Die Öffentlichkeit jenseits der Bildschirme. Das Leben jenseits von Show und Werbung. Das echte Leben. Das Dasein im neuen Diesseits.
8. Alltäglich und lebenslänglich
Der Bürger wirkt durch sein Dasein, sein Dasein ist eins mit dem entstehenden Werk. Und das Werk wirkt für sich. Der Bürger bewohnt ein Haus, das Platz bietet für vielfältige Aktivitäten und Begegnungen, aber es ist kein protziger Palast. Er trägt Kleidung, die gewählt und funktional ist, zurückhaltend und zweckdienlich. Eigen und elegant darf sie sein, nur modisch nicht, denn sein Maßstab ist nicht die Saison und das Jahr, sondern die Lebensspanne. Er weiß, dass er mit achtzig im Kern noch der sein wird, der er mit zwanzig war, und dass er zu sich in Wesen und Erscheinung in jeder Lebensphase, also jeder Werksphase Ja sagen können muss. Das schließt jede Extravaganz, die immer in der Gefahr steht, zur Exkreszenz zu entarten, kategorisch aus.
Nichts Übertriebenes, Ausschweifendes und Grelles an seinem Werk soll ablenken vom Eigentlichen. Von Ordnung, Klarheit, Stimmigkeit, Redlichkeit, Maß, Balance – sowohl in geistigen und emotionalen Dingen, als auch in der physischen Kohlenstoffwelt.
Der Lebensstil, die Lebensform dieses „Avantgarde-Bürgers“ muss der Masse als Maß gelten. Nicht als unerreichbares Maximum, sondern als konkretes realistisches Beispiel. Der maßgebliche Mensch darf nicht der Ausnahmemensch sein, nicht der Mensch des Höchstmaßes, sondern der, der dem nach und nach zu sich kommenden Neubürger ein erreichbares Ideal vorlebt.
Welche Kunst beherrscht die bürgerliche Avantgarde derart, dass man ihr darin vorbildliche Werke zutrauen dürfte? Es ist vor allem die Kunst des Umgangs mit Menschen. Es sind die Fähigkeiten, die schon immer denjenigen Lehrer auszeichneten, zu dem die Schüler leicht und gern Zutrauen fassen: Führen, ohne zu bevormunden. Belehren, ohne zu entwürdigen. Kritisieren, ohne zu beschämen. Begeistern, ohne zu berauschen. Helfen, ohne zu entmutigen. Urteilen, ohne zu verdammen. Entscheiden, ohne zu missachten. Herausfordern, ohne einzuschüchtern. Animieren, ohne sich aufzudrängen. Gebieten, ohne zu erniedrigen. Schonen, ohne zu heucheln. Nachsicht üben, ohne zu übersehen. Fähigkeiten, die aus einer Gesellschaft von schläfrigen Systemlingen eine Gemeinschaft von Aufwärtsstrebenden machen. Allereinfachste Tugenden, so könnte man meinen. Und doch scheint es radikaler Lebensentscheidungen, radikaler Befreiungsleistungen Einzelner zu bedürfen, ihnen zu Geltung und Wirkung zu verhelfen.
Es hat nicht jeder das Talent zur Bürgerlichkeit. Wir Künstler schon gar nicht. Gerade wir aber, gerade wir schief ins Leben Gebauten, wir Entlaufenen, wir auf die eine oder andere Art Verwachsenen und Verwunschenen, die wir uns bergen müssen im Bürgerlichen, wir verenden ohne diese geordnete und gesittete Welt, ohne diese Gesundheit und Strenge, die uns zulässt als Ausnahme, und zuweilen uns zujubelt als Sängern von Schönheit und Wahrheit. Niemand braucht das Bürgertum mehr als der Künstler.
In dem Maße aber wie der Bürger durch den Konsumenten, den Selbstverwirklicher und egozentrischen Imitator eines eigenen Lebens ersetzt wird, wird der Künstler durch den Designer, den Performer, den Dekorateur, den Drehbuchautor und Ausstatter massenhafter Subjektivität ersetzt. Es wird auf radikale Bürger und radikale Künstler ankommen, die sich dieser Ersetzung widersetzen. Alltäglich und lebenslänglich.
9. Was sagt eigentlich Thoreau dazu?
„Ich kenne keine ermutigendere Tatsache“, sagt Thoreau, „als die unbestreitbare Fähigkeit des Menschen, sein Leben durch bewußte Anstrengung auf eine höhere Stufe zu erheben. Es will schon etwas heißen, wenn man ein eigenartiges Bild malen, eine Statue meißeln, einigen wenigen Dingen Schönheit verleihen kann. Doch weitaus ruhmvoller wäre es, die Atmosphäre, das Medium selbst, durch welches wir hindurchsehen, zu meißeln und zu malen. Moralisch sind wir dazu imstande. Auf die Beschaffenheit des Tages einzuwirken, das ist die höchste Kunst. Jedermann hat die Verpflichtung, sein Leben auch in Einzelheiten so zu gestalten, daß es selbst in seiner feierlichsten und kritischsten Stunde als der Betrachtung würdig sich erweist.“**
Die Verpflichtung, das Leben in allen Einzelheiten so zu gestalten, dass es sich der Betrachtung würdig erweist – vielleicht ist das die beste und schönste Definition des bürgerlichen Ethos. Ich fürchte nur, in einer Epoche, die mit all diesen seltsamen Vokabeln Pflicht, Würde, Schönheit, Anstrengung, Höhe, Feierlichkeit kaum noch umzugehen weiß, werden schöne Definitionen und geflügelte Worte nicht reichen, um die hinter Burg- und Brandmauern verschanzten Ex-Bürger zu erreichen. Und die Fähigkeit des Menschen, sein Leben durch bewusste Anstrengung auf eine höhere Stufe zu erheben, würde auch Thoreau heute wohl nicht mehr für so unbestreitbar halten.
Aber morgen ist ja auch noch eine Epoche …
* Es mag hart klingen: „das Leben eines Kindes zu zerstören“, aber genau das war immer schon die unausgesprochene, und doch deutlich genug vernehmbare Drohung, die der Schule zur Macht über den Schüler verhalf: Wenn du hier nicht mitspielst, ist dein Leben zerstört. Wir geben dir schlechte Noten, wir lassen dich sitzenbleiben, wir schicken dich auf die nächst tiefere Schulform, wir verweisen dich der Schule, du bekommst keinen Abschluss, du bekommst keinen Job, du wirst kein Teil dieser Gemeinschaft werden, dein Leben ist ruiniert. Dies war die Drohkulisse, die von der Schule zusammen mit den ganz selbstverständlich in diesem Sinne kooperierenden Eltern, mit der gesamten Familie, der Nachbarschaft, dem Hausarzt, dem Fußballtrainer, dem Pastor, dem Wachtmeister, eben dem kompletten Gemeinwesen aufgebaut wurde. Diese Drohung ist heute nicht mehr aufrechtzuerhalten. Denn das Leben des Schülers, der sich verweigert, ist ja keineswegs ruiniert. Er weiß, dass er sein Leben lang komfortabel alimentiert werden wird, das Gemeinwesen interessiert ihn einen Scheiß, und eventuelle höhere Ambitionen werden in die vage Hoffnung kanalisiert, bei Castingshows oder Koch-, Shopping-, Talent-Shows aller Art irgendwie entdeckt zu werden, zumindest für die berüchtigten 15 minutes of fame. Das medial verbreitete Credo, dass jeder alles werden kann, wenn er an sich glaubt, dass man alles erreichen kann, wenn man es nur wirklich will – ganz ohne etwas zu können und mühsam erlernt zu haben –, dieses Credo hat sich vollständig durchgesetzt gegen das altbackene schulische Narrativ vom ordentlichen, fleißig beschrittenen Bildungsweg, der zu einer sicheren, respektablen bürgerlichen Existenz führt.
** Henry David Thoreau, Walden. Oder: Leben in den Wäldern. Aus dem Amerikanischen von Wilhelm Nobbe. Eugen Diederichs, Jena 1905. S. 89
Lektüreempfehlungen:
Joachim Fest: Bürgerlichkeit als Lebensform – Späte Essays. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2007
Golo Mann: Radikalisierung und Mitte. Klett Verlag, Stuttgart 1971
Jens Jessen: Was vom Adel blieb – Eine bürgerliche Betrachtung. zu Klampen Verlag, Springe 2018
Karlheinz Weißmann: Kulturbruch ’68. Die linke Revolte und die Folgen. Junge Freiheit Verlag, Berlin 2017
Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 9-10/2008: Bürger – Bürgertum – Bürgerlichkeit
Dolf Sternberger: „Ich wünschte ein Bürger zu sein.“ Neun Versuche über den Staat. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1967
Sowie:
Was war links? (vierteilige Dokumentation von Andreas Christoph Schmidt) https://www.youtube.com/watch?v=bex21sP-rO4
Wenn Sie „auf die Beschaffenheit meines Tages einwirken“ möchten … :
Marcus J. Ludwig
DE85 4305 0001 0144 0608 29
WELADEDBOC1
Danke!
© Marcus J. Ludwig 2020/2023
Alle Rechte vorbehalten